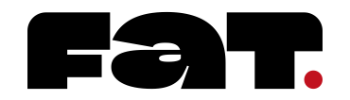Hoffnung hat ihren Ruf verloren. Sie gilt als naiv, weich oder politisch harmlos. In einer Zeit permanenter Krisen scheint sie fehl am Platz. Wer hoffnungsvoll spricht, wird schnell verdächtig, die Realität nicht ernst genug zu nehmen.
Dabei ist Hoffnung heute alles andere als bequem. Sie ist unbequem, weil sie Verantwortung verlangt.
Der öffentliche Diskurs funktionier zunehmend im Alarmmodus. Alles ist dringend, alles ist Krise, alles erfordert sofortige Reaktion. Diese Dauererregung erzeugt Aufmerksamkeit, aber sie hinterlässt wenig Orientierung. Wenn jede Gegenwart als Ausnahmezustand verhandelt wird, bleibt kaum Raum für Gestaltung. Man reagiert. Man kommentiert. Man erschöpft sich.
Kultur hatte einmal eine andere Rolle. Sie war nicht nur Diagnose, sondern Entwurf. Sie zeigte nicht nur, was fehlt, sondern was denkbar wäre. Hoffnung war dabei kein sentimentales Versprechen, sondern ein Akt der Vorstellungskraft. Eine bewusste Entscheidung gegen Stillstand.
Heute wird Hoffnung oft mit Verdrängung verwechselt. Als würde nur derjenige ernsthaft politisch sein, der permanent das Scheitern betont. Doch Kritik ohne Hoffnung wird zynisch. Sie beschreibt präzise – und endet im Nichts. Hoffnung ohne Kritik hingegen bleibt leer. Beides braucht einander.
Hoffnung bedeutet nicht, Komplexität zu ignorieren. Sie bedeutet, sie auszuhalten, ohne handlungsunfähig zu werden. Sie akzeptiert Widersprüche, ohne sich darin einzurichten. Sie verweigert sich der bequemen Pose der Resignation.
Vielleicht ist Hoffnung heute radikal, weil sie sich dem Daueralarm entzieht. Weil sie nicht jede Empörung mitnimmt. Weil sie Tiefe über Tempo stellt. Hoffnung sagt: Wir wissen, wie ernst die Lage ist – und wir geben die Zukunft trotzdem nicht preis.
Ich verstehe Hoffnung nicht als Gefühl, sondern als Haltung. Als kulturelle Praxis. Als etwas, das man immer wieder neu einüben muss. Gerade dann, wenn es schwerfällt.