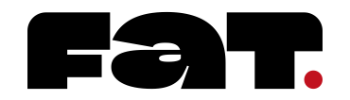Sex ist sichtbarer geworden. Offener. Gesprächsfähiger. Gleichzeitig war er selten so stark normiert. Offenheit gilt als Ideal. Lust als Voraussetzung. Selbstsicherheit als Maßstab. Wer davon abweicht, fühlt sich schnell falsch.
Sexuelle Freiheit wird oft wie ein Ziel behandelt, das man erreichen kann. Aufgeklärt, reflektiert, experimentierfreudig. Diese Vorstellung erzeigt Druck. Sie macht Lust zur Leistung. Und Nähe zur Erwartung.
Dabei ist Sexualität kein Zustand, den man abhakt. Sie verändert sich. Mit Beziehungen, mit Erfahrungen, mit Lebensphasen. Lust ist nicht konstant. Nähe ist nicht planbar. Körper funktionieren nicht immer so, wie wir es uns wünschen – oder wie es von ihnen erwartet wird.
Die gesellschaftliche Debatte hat wichtige Fortschritte gebracht. Konsens, Diversität, queere Perspektiven, Enttabuisierung. Gleichzeitig entsteht eine neue Form von Normativität. Wer nicht ständig interessiert, offen oder experimentierfreudig ist, gilt schnell als defizitär.
Gerade deshalb braucht es mehr Ehrlichkeit. Mehr Raum für Unsicherheit. Mehr Akzeptanz dafür, dass sexuelle Selbstbestimmung auch bedeutet, Nein zu sagen. Oder Phasen zu haben, in denen Sex keine zentrale Rolle spielt.
Körper sind politisch. Aber sie sind auch privat. Sie tragen Geschichte. Prägung. Verletzlichkeit. Lust entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie brauch Sicherheit. Vertrauen. Zeit.
Eine progressive Perspektive auf Sex verzichtet auf Ideale. Sie fragt nicht, wie Sex sein sollte, sondern wie er sich anfühlt. Sie erlaubt Ambivalenz. Sie erkennt an, dass Freiheit nicht darin besteht, alles zu wollen – sondern wählen zu können.
Sex als Teil von Lifestyle heißt nicht Inszenierung. Es heißt Beziehung. Zu sich selbst. Und zu anderen. Ohne Drehbuch.